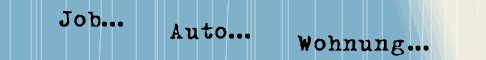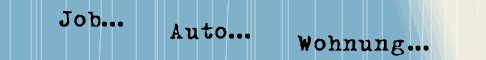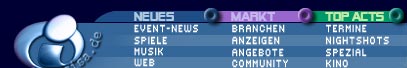26/02 A Beautiful Mind 




 |
| Gebannt betrachtet John Nash (Russell Crowe) die Formeln, aus denen er eine eigene Wissenschaft entwickeln möchte. Bild von: UIP |
Viel hat sich in der amerikanischen Universitätsstadt Princeton in den letzten 50 Jahren nicht getan. Natürlich, elektronische Kommunikationsmittel sind ebenso Alltag geworden wie Diskotheken, legere Kleidung auch auf dem Campus und ausländische Studenten. Aber: Der besondere Geist, der die neugotischen Gebäude umweht, ist immer noch da. Beschreiben kann man ihn nur schwer, erahnen wohl: In diesen Räumen wird geforscht, gelehrt und nachgedacht wie an wenigen anderen Orten der Welt. "A Beautiful Mind" erzählt die Geschichte eines Mannes, der für diesen Platz wie geschaffen scheint. Wild, unkonventionell, doch auch talentiert und motiviert. Eine Mischung, deren Explosivität ungeahnte Kräfte freisetzt, aber gleichzeitig zu einer menschlichen Katastrophe führt.
Princeton, 1947: John Nash (Russell Crowe) ist ein wenig anders als seine Kommilitonen. Das übliche Uni-Getue geht ihn nichts an, seine Interessen gelten in erster Linie der Wissenschaft. Doch besucht er keineswegs die Vorlesungen, die sein Studienplan vorsieht. Lieber sitzt er tagelang an seinem Schreibtisch, um eine eigene Theorie, eine eigene Wissenschaft zu entwickeln. Ausgerechnet in einer Kneipe kommt ihm die Idee, auf die sein ganzes Leben aufbauen wird. Er beobachtet seine Mitstudenten beim Wettstreit um eine schöne Blondine - ein Geplänkel, das offenbar System hat, denn Nash entwickelt daraus eine Arbeit zum Thema "Spiel- und Entscheidungstheorie".
 |
| John Nash (Russell Crowe) gilt in Princeton zunächst als Sonderling - akzeptiert wird er vor allem wegen seiner gewitzten Argumenta- tionsweise und seinen unkonventionellen Ideen. Bild von: UIP |
Mit dem Posten, den er bald darauf erhält, ist er nicht zufrieden. Immerhin spielte die Wissenschaft beim Sieg der Amerikaner im Zweiten Weltkrieg eine große Rolle - Nash meint, dass sich auch der "Kalte Krieg" durch die Wissenschaft siegreich beenden lassen müsste. Sein Interesse gilt der Code-Dechiffrierung. Schnell spürt er Zusammenhänge auf und taucht mit Leib und Seele in die neue, geheime Arbeit auf. Sein Kontaktmann: der mysteriöse Agent William Parcher (Ed Harris). Nashs Frau Alicia (Jennifer Connelly) leidet derweil unter den Obsessionen ihres Mannes. Denn er geht in der fixen Idee auf, in sämtlichen Printpublikationen Amerikas seien versteckte Hinweise über eine bevorstehende Invasion versteckt. Schließlich ist er völlig in einer anderen Welt verloren. Die Diagnose: Schizophrenie. Doch Nash lässt sich nicht bezwingen: Er kämpft gegen seine Krankheit an und widmet sich im hohen Alter wieder der Forschung, bis er 1994 schließlich den Nobelpreis erhält.
 |
| In der schönen Alicia (Jennifer Connelly) findet John Nash (Russell Crowe) die Liebe seines Lebens. Bild von: UIP |
Regisseur Ron Howard ist mit "A Beautiful Mind" ein Film gelungen, der die - zweifelsohne existierenden - Verbindungen von Genie und Wahnsinn eindrucksvoll dokumentiert. Seinen Schauspielern verlangte er dabei einiges ab: Weil er den Film streng chronologisch abdrehte, stellte die Metamorphose des John Nash für alle Beteiligen eine emotionale Herausforderung der Extraklasse dar. Gerade Russell Crowe und Jennifer Connelly, beide für ihre Leistung mit dem Golden Globe ausgezeichnet, meisterten das mit Bravour. Ihr Zusammenspiel gewann vor allem dadurch, dass sie das echte Ehepaar Nash persönlich kennen lernen konnten: "A Beautiful Mind" basiert auf einer wahren Geschichte, wie im Film ist Nash auch in der Realität mittlerweile wieder völlig rehabilitiert.
 |
| Regisseur Ron Howard (rechts) gibt seinem Hauptdarsteller Russell Crowe wertvolle Tipps, wie er seine Figur anzulegen hat. Ob Crowe dafür den Oscar erhält? Bild von: UIP |
Auf der Leinwand überzeugen freilich vor allem die Szenen, in denen Nashs Schizophrenie die Handlung an sich reißt: Geschickt verwischt Ron Howard Sein und Schein, Russell Crowe vermittelt das mit einer Intensität, die beim Zuschauer Staunen hervorruft - und führt ihn damit mehr als nur einmal hinters Licht. Gegen Ende des Filmes besinnt sich der Regisseur ("Der Grinch", "Apollo 13") leider auf eine klassische Hollywood-Untugend: Das - nicht nur, was die Länge angeht - überzogene Ende verschlechtert den Gesamteindruck erheblich. Diese knapp 20-minütige Lektion in Sachen Rührstück und Seifenoper hätte sich Howard getrost sparen können.