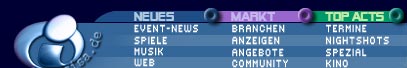13/05 Iris 




 |
| Bild von: Buena Vista |
Momente der Stille kann es bei Richard Eyres Drama "Iris" nicht genug geben, kein Zuviel an bedeutungsschwangeren Gesten - und vornehmer Zurückhaltung. Das Porträt der Schriftstellerin Iris Murdoch befasst sich vordergründig mit der Krankheit einer lebenslustigen Frau, doch wesentlich beeindruckender ist die verzweifelt aufopfernde Liebe des Mannes, der mit ihr geht.
Bezieht man sich auf den Titel des Werkes, man könnte von Themaverfehlung sprechen. So lange die schweigende Autorin in den Mittelpunkt gerückt wird, bleibt der Zuschauer auf Distanz. Selbst die aufflackernden Szenen ihrer wilden Jugend sind nur eine angestrengt wirkende Demonstration von übersteigertem Selbstbewusstsein, das Kate Winslet leidlich visualisiert. Sie entweicht damit endlich ihren Jammer-Rollen, doch ihr ständiges Lachen ist eine gestelzte Darstellung von Enthusiasmus. Es wirkt zudem beinahe schon albern, dass das einzige gemeinsame Merkmal zwischen der alten und der jungen Philosophin die Frisur ist.
Was der Betrachter erfährt? Die Autorin ist eine Rebellin, mindestens ab jenem Moment, in dem sie merkt, dass ihr Worte gehorchen. Sie genießt es in vollen Zügen zu leben, erobert den Literaturkritiker John (Jim Broadbent) und neben ihm zahlreiche andere Frauen und Männer.
 |
| Bild von: Buena Vista |
Er wird bleiben. 40 Jahre lang lebt der zerstreute Professor John Bayley an ihrer Seite, vergöttert sie, bewundert ihren Elan und ihr Können. Zwar lässt er sich von Iris mit Füßen treten, doch das spielt keine Rolle, denn er merkt es nicht, ist blind vor Liebe. An dem Tag, an dem die Ärzte bei der mittlerweile etwas gesetzteren Iris Alzheimer diagnostizieren, drehen sich die Verhältnisse langsam um.
Die große Autorin fällt vom Thron, ist auf die Unterstützung ihres Mannes angewiesen. Während sie sich die Frage stellt, wie man den Wahnsinn denn erkennen soll, schließlich lebe man doch immer in seinen Gedanken, beginnt der zerstreute Professor Haushalt und Tagesablauf zu organisieren. Einzigartig rührend erledigt er alles, blickt mit seinen meeresblauen Augen seine Iris an, trägt sie auf Händen, lobt sie weiter in den Himmel, und es steht ihm ins Gesicht geschrieben, dass er es nicht fassen kann, dass sie ihn genommen hat.
 |
| Bild von: Buena Vista |
Der Rest ist ein elegantes Schweigen vor einer Frau, die in der Literatur Großes leistete. Da der Regisseur keinen Weg findet, wortlos zu zeigen, was in ihr vorgeht, erfährt der Zuschauer nur wenig über die 1999 verstorbene Frau. Lücken in der Biografie sind nichts Schlechtes, lockern das fein verwobene Gefüge aus Vergangenheit und Gegenwart auf. Nur wurde vergessen, Eckpfeiler zu setzen, die der Orientierung dienen. Ein erschrockener Blick, ein überraschter Gesichtsausdruck müssen reichen. Judi Dench spielt nach der Weniger-ist-mehr-Maxime, die Russell Crowe sehr viel effektiver in "A Beautiful Mind" einsetzte. Hier wird zurückgehalten, verschleiert, geschönt.
Doch wann immer der Blick auf Jim Broadbent gerichtet wird, berührt dieser Film. Als Zuschauer bleibt man fast unfreiwillig an der Figur Bayley hängen. Während man an Iris abgleitet, transportiert er durch die ihm innewohnende Tragik Emotion. Langsam tritt der Gatte aus ihrem Schatten. Etwas, das der echte Bayley nie geschafft hat. Er schrieb lediglich die Memoiren, die Richard Eyre für seinen Berlinale-Beitrag als Basis dienten.
Wie eine späte Belohnung wirkt es, dass Broadbent den Oscar für seine grandiose darstellerische Leistung erhielt, während Judi Dench nicht ausgezeichnet wurde. Ganz wie im Leben war sie in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" und er als "Bester Nebendarsteller" nominiert. Doch es ist alleine sein Verdienst, dass "Iris" immerhin ein trauriger Film über das Altwerden geworden ist und eine neue Definition des Begriffs Stärke liefert.